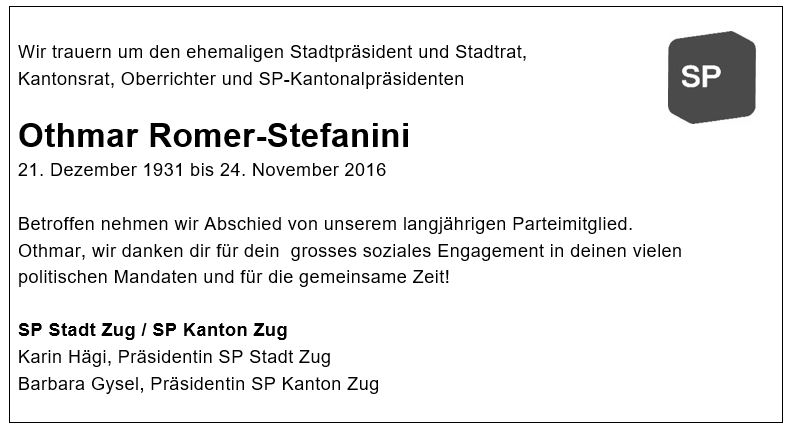
Aus:
Da liegt Zug drin. Soziale und demokratische Spurensuche im Kanton Zug
Barbara Gysel, Armin Jans, Martin Amrein (Hrsg.)
100 Jahre Sozialdemokratische Partei im Kanton Zug, 1913–2013. ISBN 978-3-033-04207-0
Da liegt Zug drin. Auszug: Interwiev mit Othmar Romer (pdf)
Othmar Romer
Die Türen des Lifts öffnen sich erst im 11. Stock. Hier treffen wir Othmar Romer in seiner Wohnung, in der er mit seiner Frau lebt. Der 82-Jährige war von 1994 bis 1998 der erste SP-Stadtpräsident von Zug. Von seinem Balkon aus hat Othmar Romer einen schönen Ausblick auf die Stadt, deren Geschicke er einst lenkte, aber auch auf den Zugersee und die Berge dahinter, die er als passionierter Wanderer noch immer regelmässig besteigt.
Herr Romer, wie sind Sie aufgewachsen?
Wir waren eine Arbeiterfamilie mit sieben Kindern, mein Vater war Spinnereiarbeiter. Die Mutter war zu Hause und schaute zu den Kindern. Das war mitten in den Kriegsjahren. In der Nacht hörten wir Bomber über die Häuser fliegen, die dann Friedrichshafen und andere Städte bombardierten. Ich hatte damals ein Dachzimmer und sah einmal sogar, wie ein amerikanisches Flugzeug in den Zugersee stürzte.
Wie begannen Sie, politisch aktiv zu werden?
Mein Vater war christlichsozial und im Vorstand bei den Gewerkschaften tätig. Die Vorstandsmitglieder hatten häufig Sitzungen bei uns zu Hause. Als kleiner Bub hatte ich ihnen jeweils unter dem Tisch versteckt zugehört. Das hat mich früh politisiert. Nachdem ich geheiratet hatte, bin ich in den 1950er-Jahren nach Zug gezogen. Da hatte ich festgestellt, dass ich einen sehr hohen Mietzins zahlen musste. Von den 500 Franken meines Salärs, das ich bei Landis+Gyr verdiente, musste ich 260 Franken für die Miete bezahlen. Um etwas dagegen zu unternehmen, stieg ich in die Politik ein. Ich hatte das Gefühl, die Sozialdemokraten nehmen sich dieser Probleme am besten an.
Gibt es politische Figuren, die Sie prägten?
Es gab einen Gewerkschaftssekretär, der mich mit seiner Persönlichkeit sehr beeindruckte. In der Partei war es der ehemalige Regierungsrat Meienberg, der mich prägte. Mit ihm arbeitete ich eng zusammen. Nachdem ich das Beitrittsgesuch an die SP geschickt hatte, kam Meienberg persönlich zu mir nach Hause, um zu überprüfen, was da für ein Halbwilder in die Partei möchte. Schliesslich war ich damals der erste kaufmännische Angestellte in der SP Zug. Anfang der 1970er-Jahre wurde ich Präsident der kantonalen Partei. Damals stiessen all die Achtundsechziger in die Partei. Das war eine turbulente, aber interessante Zeit mit vielen Auseinandersetzungen.
Ab 1978 waren Sie zwanzig Jahre lang im Zuger Stadtrat, die letzten vier Jahre als Stadtpräsident. Wie kamen Sie dazu?
Als Parteipräsident hatte ich natürlich Vorteile bei der Kandidatur für den Stadtrat und wurde auch gewählt. 1994 kam es dann zu einer besonderen Situation: Gleich drei Stadträte traten zurück, und ich spürte in Gesprächen mit der Bevölkerung, dass ich eine gute Chance hatte, Stadtpräsident zu werden. Deshalb trat ich als Kandidat gegen einen Freisinnigen an und wurde tatsächlich mit einem sehr guten Resultat gewählt.
Wieso waren Sie nicht länger als vier Jahre Stadtpräsident?
Wegen meines Alters. Eigentlich überlegte ich mir schon vor der Kandidatur zurückzutreten, da ich bereits 63 war. Aber da die Gelegenheit einmalig war, habe ich doch kandidiert. Eigentlich war es damals undenkbar, dass ein SPMann Stadtpräsident wurde. Da es aber den Bürgerlichen an guten Kandidaten mangelte, hiessen sogar linke CVP-Politiker meine Kandidatur gut.
Während Sie noch im Amt waren, hatten Sie jeweils Mühe, rechtzeitig auf den Zug zu kommen, da Sie auf der Strasse immer wieder gegrüsst und in ein Gespräch verwickelt wurden. Werden Sie auch heute noch häufig angesprochen?
Wenn ich vom Büro zum Bahnhof ging, musste ich tatsächlich immer zehn Mi – nuten mehr einberechnen. Heute ist das nicht mehr so. Die Jungen kennen mich nicht mehr. Aber es gibt immer noch ab und zu Leute, die mich fragen, wie sie abstimmen sollen.
Auf welches politische Engagement sind Sie besonders stolz?
Schon auf das Amt als Stadtpräsident. Aber auch, dass ich von 1966 bis 1970 als einer der Jüngsten im Kantonsrat war. Stolz bin ich zudem auf die Alterspolitik während meiner Zeit als Stadtrat. Damals sind verschiedene Alterszentren und Alterswohnungen entstanden.
Sie sind ja immer noch in Kontakt mit Menschen, die heute in diesen Altersheimen wohnen. Funktionieren diese Institutionen heute so, wie Sie es sich bei deren Bau vorgestellt hatten?
Weitestgehend schon. Wir merkten allerdings, dass Alterswohnungen einem Altersheim angeschlossen sein sollten, wegen der Betreuung und der Organi – sation der Mahlzeiten. Diese Probleme konnten wir mit dem Bau zusätzlicher Altersheime lösen.
Was irritiert Sie im Kanton Zug?
Die Bautätigkeit sollte man besser regulieren. Wenn es so weitergeht wie bisher, ist der Kanton Zug in wenigen Jahren überbaut. Von meiner Wohnung aus sieht man im Moment etwa vierzehn Kräne.
Welches sind im Kanton Zug derzeit (2013) die vordringlichen Themen?
Primär sollten wir die Bautätigkeit einschränken. Das ist ein allgemeiner Wunsch der Bevölkerung. Zudem sind die Mietzinsen für viele Menschen ein Problem. Man müsste die Genossenschaften besser unterstützen. Ich habe einmal in einer Genossenschaftswohnung gewohnt. Die Leute hatten einen guten Kontakt untereinander. Das gefiel mir sehr.
Zug ist in den vergangenen Jahrzehnten enorm gewachsen. Was sind die Konsequenzen davon?
Das führt zu einer Umschichtung der Bevölkerung. Viel mehr vermögende Leute ziehen nach Zug, was auch politische Auswirkungen hat.
Die Bürgerlichen sprechen mittlerweile von «Wachstum mit Grenzen», wie ordnen Sie das ein?
Da spielt der Druck der Bevölkerung mit. Es ist interessant, dass das bis in bürgerliche Kreise eindringt. Ich hoffe, dass wir gemeinsam Grenzen festlegen können.
Seit 1999 ist die SP Zug nicht mehr im Nationalrat vertreten, seit 2007 nicht mehr im Regierungsrat. Wo liegen die Gründe für diese Entwicklung?
Das Zusammengehen mit der Alternative – die Grünen hat eine Rolle gespielt. Sie hatten relativ gute Leute. Die SP war weniger gut aufgestellt. Der gemeinsame Wahlkampf hat die Alternativen – die Grünen bevorzugt.
Nach dem schlechten Abschneiden der SP Zug bei den Nationalratswahlen 2007 sagten Sie der «Neuen Zuger Zeitung», dass das Parteileben in der Zuger SP nicht so gut entwickelt sei. Wie schätzen Sie die Situation heute ein?
Ich glaube, das hat sich eher gebessert. Man trifft sich wieder mehr. Zu meiner Zeit in den 1970er- und 1980er-Jahren hatten wir noch ein Lokal an der Dorfstrasse, in dem wir uns regelmässig trafen. Da kamen jeweils viele Leute, und wir konnten unsere Gedanken austauschen. Viele Ideen wurden da geboren. Das Parteileben hat sehr darunter gelitten, als wir das Lokal dann leider aufgaben. Diesen näheren Zusammenhalt vermisse ich heute schon, auch dass man einfach zusammenkommt, plaudert und einmal nicht über Politik spricht.
Sie sprachen sich bei den letzten Regierungsratswahlen gegen Listenverbindungen aus. Wie schätzen Sie die Situation für die nächsten Regierungsratswahlen ein?
Ich denke, bei den nächsten Wahlen sollten wir versuchen, wieder auf die eigenen Füsse zu kommen.
Wie hat das Aufkommen der Grünliberalen Partei in den letzten Jahren die politischen Verhältnisse verändert?
Nicht stark. Die paar wenigen Mandate der Grünliberalen sind nicht so erheblich. Allerdings hatte die Partei schon vielerorts Erfolg. Es besteht schon die Möglichkeit, dass sie noch weiteren Aufschwung erhält.
Sie sind seit vielen Jahren Gewerkschafter. Wie haben Sie in dieser Zeit die Zusammenarbeit zwischen Gewerkschaften und der SP erlebt?
Zu meiner aktiven Zeit war das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und SP immer sehr gut: Wir kamen regelmässig zusammen und besprachen die aktuellen Probleme. Heute leiden die Gewerkschaften allerdings an Mitgliederschwund. Die Rolle der Gewerkschaften hat sich verändert. Sie sind weniger wichtig geworden, da es immer weniger Arbeitende im herkömmlichen Sinne gibt. Heute dominiert der Mittelstand.
Wenn Sie die SP Ihrer Jugend mit der heutigen vergleichen, wo sehen Sie die Unterschiede?
Als ich eingetreten bin, war die SP sogar noch schwächer als heute. Wir hatten manchmal Parteiversammlungen mit sieben oder acht Leuten. Dafür war es sehr lebhaft. Die wenigen waren eher ältere Semester. Trotzdem hatten wir etwa zehn Mandate im Kantonsrat sowie im Grossen Gemeinderat und waren im Regierungsrat und im Stadtrat vertreten. Heute ist die Situation eigentlich ganz ähnlich.
Wie kamen Zu- und Abnahmen der Parteistärke zustande?
Der Aufschwung kam mit der 68er-Bewegung. Viele Junge kamen plötzlich in die Partei. Die Achtundsechziger wurden aber auch älter. Sie machten Karriere, wurden Banker oder Professoren. Das hat schon einen Wandel bewirkt. Es sind dann nicht mehr so viele Neue nachgerückt. In letzter Zeit hat sich das etwas gebessert. Gerade junge Frauen rücken nun nach. Das ist natürlich sehr positiv. Die Partei litt immer darunter, dass sie zu wenige Frauen hatte.
Hat sich der Umgang innerhalb der Partei im Vergleich zu früher verändert?
Ja, sicher. Als in den 1970er-Jahren die Jungen in die Partei kamen, hatten wir sehr viele intensive Auseinandersetzungen. Heute ist alles sehr viel friedlicher, es geht vor allem um Sachgeschäfte. Die Auseinandersetzungen damals waren sehr interessant und brachten Leute in die Partei, weil man sah, dass hier etwas passierte.
Im Stadtrat hat die SP noch immer Erfolg. Immerhin ist der Stadtpräsident ein SP-Mann.
Ja, ich hoffe, dass es auch so bleibt!
Wie erklären Sie sich das im Vergleich zu den Misserfolgen im Kantons- und Regierungsrat?
Das hat wohl mit Persönlichkeiten zu tun. Dolfi Müller war dafür bekannt, ein guter Parlamentarier im Grossen Gemeinderat zu sein.
Müsste Dolfi Müller für den Regierungsrat kandidieren?
Das könnte ich mir schon vorstellen.
Wie sehr beeinflusst es einen Politiker, auf die Gunst der Wählenden angewiesen zu sein?
Wenn man etwas anpackt, überlegt man sich schon, wie das in der Bevölkerung ankommt. Ist man aber überzeugt von einer Sache, zieht man es auch bei Widerstand trotzdem durch. Zu meiner Zeit war etwa die Einrichtung der Stelle der Kulturbeauftragten umstritten. Auf der Strasse wird man dann auch mal angehauen und gefragt, was man denn da wieder für einen Seich gemacht habe.
War das manchmal auch mühsam?
Wenn man gerne mit Leuten verkehrt, ist das nicht mühsam. Im Gegenteil, da kann man etwas lernen. Ich ging immer gerne auf die Strasse, um Unterschriften zu sammeln. Vor den Wahlen ging ich immer von Haustüre zu Haustüre. Ich kam jeweils fast nicht mehr weg, kaum war ich im Haus, schenkte man mir etwas zu trinken ein.
